Psychoanalytiker wird man früh – man merkt es aber nicht gleich.
Erinnerungen und Geschichten
Das Einzelschicksal eines Psychoanalytikers spiegelt die deutsche Nachkriegsgesichte wider, ein bisschen 2. Weltkrieg, ein bisschen DDR, das Westberlin bis zur Studentenrevolte. Der Autor zieht immer wieder Verbindungen zwischen damals und heute, auch zwischen dem brasilianischen und deutschen Teil der Familie, es gibt schließlich einen Migrationshintergrund seit 1742. Das Ganze ist in einem ironisch-selbstironischen Stil gehalten, der das Schlimme erträglicher macht.
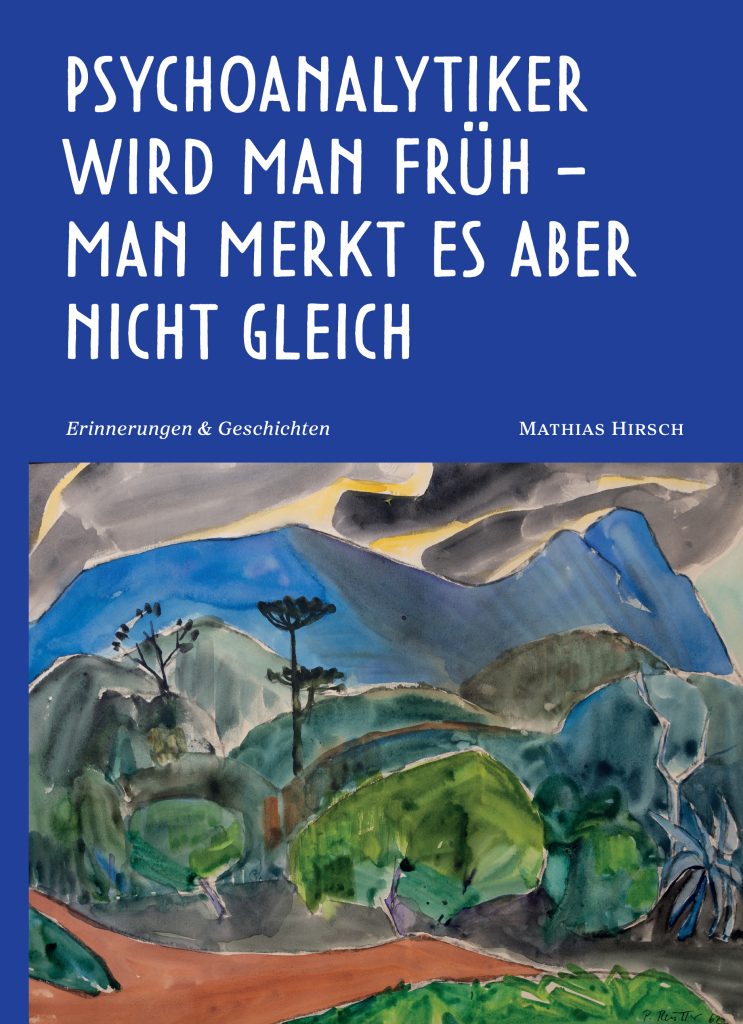
erste Auflage Nov. 2025
334 Seiten, brochiert
ISBN 9783819274626
Kreativität und Schuld als Wurzeln der Kultur
Mythologie, Literatur, Musik und Film im Spiegel der Psychoanalyse
Aus der Perspektive der Psychoanalyse liegt die Funktion menschlicher Kultur zum einen in der Kontrolle der antisozialen Tendenzen des Menschen. Auf der anderen Seite sieht sie die Kultur in einem engen Verhältnis zum Spiel und zur Kreativität, mit denen der Mensch versucht, Ängste und Ohnmachtsgefühle zu beherrschen. Mathias Hirsch spürt vor diesem Hintergrund dem Verhältnis von Kultur und Psychoanalyse nach: Mit Blick auf Mythologie und Literatur beleuchtet er etwa die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit bei Thomas Mann, das Ringen um Schuld und Schuldgefühle in Fjodor Dostojewskijs Romanen oder Formen des Vampirismus. Ein weiterer Fokus liegt auf filmtheoretischen Überlegungen, die die Fragen aufwerfen, welche Wirkung und Funktion der Musik in Filmen zukommt, wie pathologische Trauer inszeniert wird bzw. welche Dimensionen der Deutung im Motiv des Hauses zum Tragen kommen.
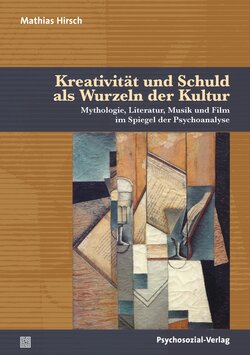
Psychosozial-Verlag
Buchreihe: Bibliothek der Psychoanalyse
ISSN: 2364-0588
223 Seiten, Broschur
November 2023
ISBN-13: 978-3-8379-3269-0
Die Therapie als Beziehungsraum
Modifizierte psychoanalytische Traumatherapie
Welche Bedeutung hat die therapeutische Beziehung in der psychoanalytischen Behandlung schwer traumatisierter Patient*innen? Mathias Hirsch versteht Therapie als Beziehungsraum, in dem Übertragungs-, Gegenübertragungs-, Identifikations- und Projektionsprozesse ablaufen. Er zeigt, wie in psychoanalytischen Einzel- und Gruppenpsychotherapien mit Metaphern und konstruierten Bildern gearbeitet wird, stellt Phasenabläufe und Krisensituationen dar und hebt die Wichtigkeit von Körpersprache, Humor und verschiedenen Formen der Liebe in der Therapie hervor. Eine besondere Bedeutung kommt hier der analytischen Gruppenpsychotherapie für die Entwicklung von Symbolisierung und Mentalisierung traumatisierter Patient*innen zu. Fachleute aus Psychoanalyse, Trauma- und Verhaltenstherapie können so ihr Wissen und ihre Fähigkeit für die Behandlung schwer traumatisierter Patient*innen erweitern und Übertragungs-Gegenübertragungsdynamiken besser verstehen.
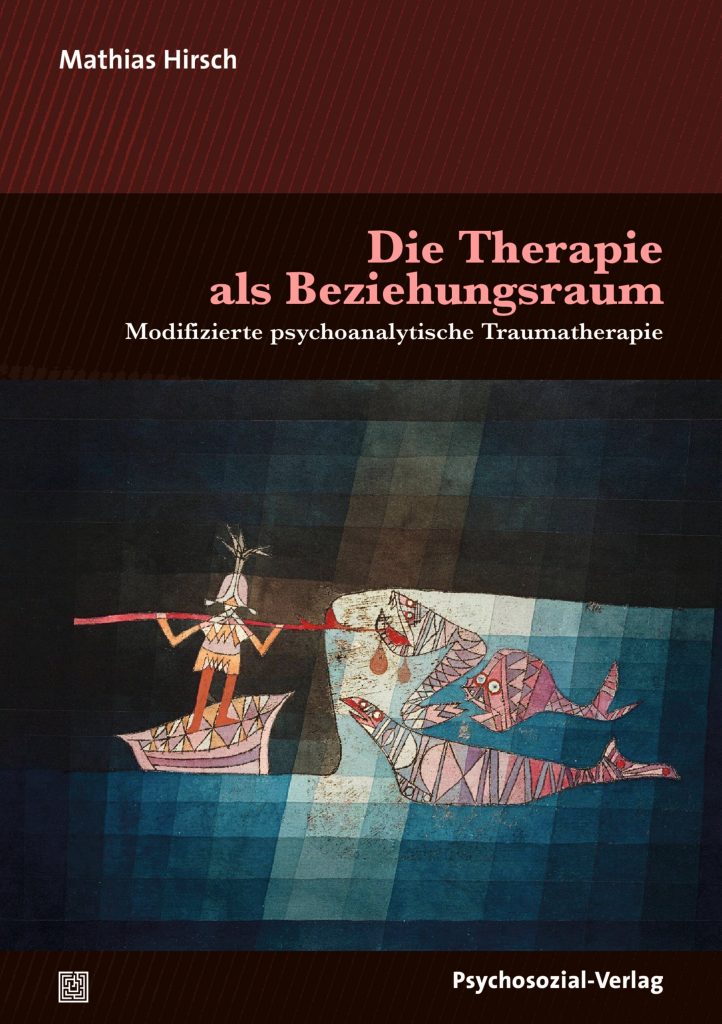
Psychosozial-Verlag
Buchreihe: Bibliothek der Psychoanalyse
217 Seiten, Broschur
erste Auflage, November 2022
ISBN-13: 978-3-8379-3180-8
Traumatische Realität und psychische Struktur
Zur Psychodynamik schwerer Persönlichkeitsstörungen
Mathias Hirsch vermittelt ein psychodynamisches Verständnis schwerer Psychopathologien. Ausgehend von Sándor Ferenczis Entdeckungen zu familiären Traumatisierungen entwickelt Hirsch ein Konzept einer modernen psychoanalytischen Traumatologie, in deren Zentrum die Internalisierung der Gewalterfahrung als Abwehr steht. Neben physischer und sexueller Gewalt, emotionalem oder narzisstischem Missbrauch können auch nicht betrauerte Verluste traumatisch wirken. Die Traumafolgen für Betroffene reichen von sexueller Perversion, Beziehungsstörungen, pathologischen Schuldgefühlen bis hin zu destruktivem Verhalten wie Selbstverletzungen oder Essstörungen.
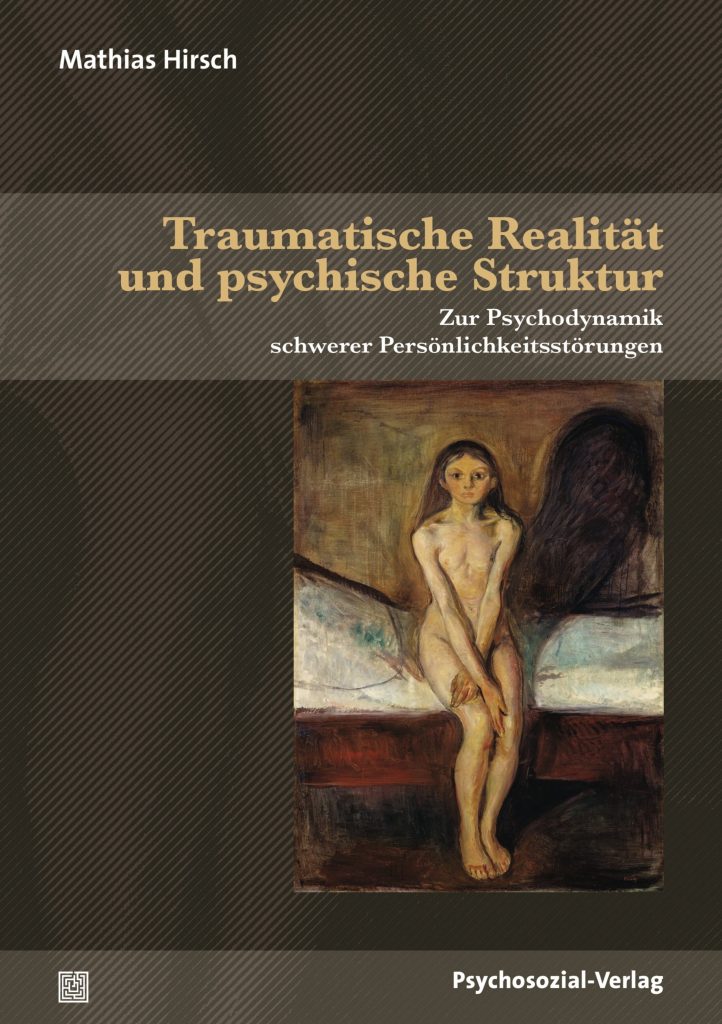
Psychosozial-Verlag
Buchreihe: Bibliothek der Psychoanalyse
253 Seiten, Broschur
erste Auflage Juni 2022
ISBN-13: 978-3-8379-3130-3
Schuldgefühl
Während Schuldempfinden in der Regel hilfreich ist, um das soziale Miteinander zu regulieren und Reife zu ermöglichen, erschweren pathologische Schuldgefühle das Leben und den eigenen Entwicklungsprozess. Die Gründe für irrationale Schuldgefühle liegen in der Kindheit und lassen sich auf negative Erfahrungen zurückführen wie physische oder sexuelle Gewalt, emotionalen Missbrauch, nicht betrauerte Verluste oder eine unerwünschte Existenz. Solche Erlebnisse werden verinnerlicht und erzeugen traumatische Introjekte, die Beziehungs- und Identitätsstörungen zur Folge haben und Schuldgefühle verursachen.
Mathias Hirsch zeigt, wie wichtig es ist, in der Psychotherapie sorgfältig zwischen realer Schuld und irrationalen Schuldgefühlen zu unterscheiden und dem Phänomen der negativen therapeutischen Reaktion sowie besonderen Gegenübertragungsreaktionen sensibel zu begegnen. Er nimmt eine psychoanalytisch fundierte Systematisierung des Schuldgefühls vor und differenziert zwischen Basis-, Vitalitäts-, Trennungs- und traumatischem Schuldgefühl.

Psychosozial-Verlag, Gießen.
2020
138 Seiten, brochiert
ISBN: 978-3-8379-3007-8
Das Phänomen Liebe
Wie sie entsteht, was sie in der Psychotherapie für Probleme macht und warum sie missbraucht werden kann
Mathias Hirsch untersucht die Liebe innerhalb und außerhalb der Psychotherapie und stellt das Spektrum der verschiedenen Liebesformen in der Therapie vor. Er betont die Ambivalenz, die mit der Liebe stets verbunden ist: Neben dem ersehnten Glück birgt sie die Angst vor Abhängigkeit von der Macht des Anderen, Entindividualisierung in der Verschmelzung sowie Trennungsangst.
Der Autor beleuchtet, wie aus dem Phänomen der Liebe einst die Psychoanalyse entstand, und zeigt, dass die Übertragungsliebe bis heute ein kräftiger Motor in der Therapie bleibt. Darüber hinaus wendet er sich der weitgehend tabuisierten Problematik der sexuellen Beziehung in der Therapie zu, die den analytischen Raum zerstört: Sie ist immer narzisstischer Machtmissbrauch und Missbrauch der kindlichen Liebe in der Übertragung. Seine Überlegungen illustriert der Autor anschaulich anhand klinischer Fallbeispiele.
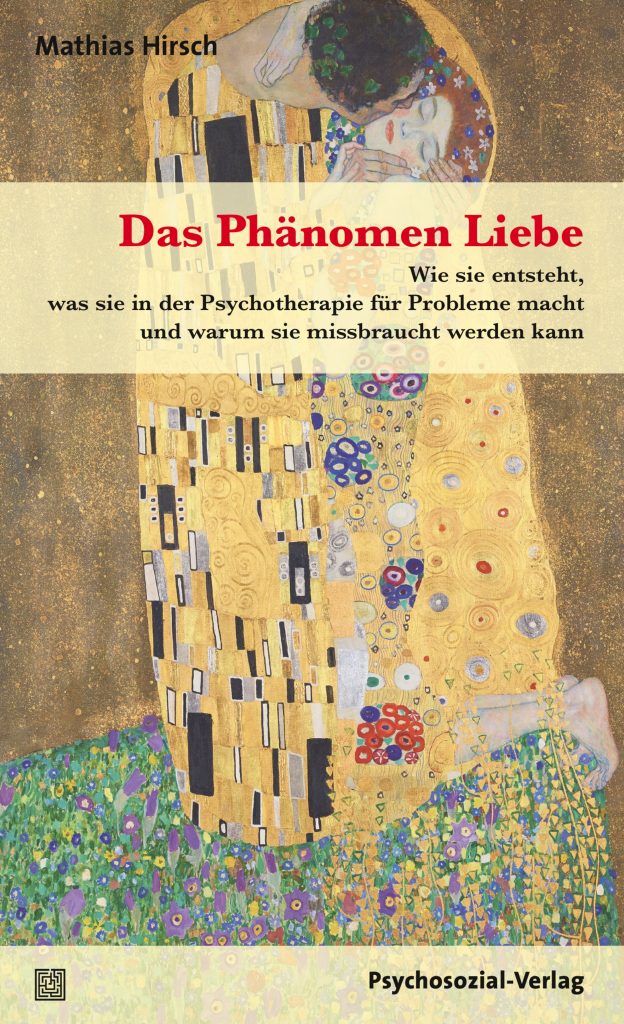
Buchreihe: Bibliothek der Psychoanalyse
136 Seiten, Broschur
zweite Aufl. 2024
Erschienen: Juni 2018
ISBN-13: 978-3-8379-2761-0
Hirsch, M. (2018):
Körperdissoziation.
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
Wie lässt sich das Phänomen erklären, dass Menschen ihren eigenen Körper attackieren und sich selbst verletzen? Störungsbilder wie Selbstbeschädigung, Essstörungen, Hypochondrie oder Dysmorphophobie enthalten Selbstheilungsversuche, indem ein (Körper-)Teil geopfert wird, um das Ganze, das Selbst, zu retten. So wird das fragile Selbst, die Identität gesichert oder soll es wenigstens. In der frühkindlichen Entwicklung folgt eine Integration des Körperselbst in die Repräsentanz des Selbst. Frühe Traumata stören diese Integration; spätere, darauf aufpfropfende Traumata führen häufig zu Dissoziationen des Körperselbst. Der Körper kann wie ein Objekt verwendet werden. Der Zweck der Dissoziation ist die Lokalisierung der traumatischen Gewalt, die in das Selbst eindringt, in den abgespaltenen Körper, so dass das Gesamtselbst überlebt. Beispiele von Patientinnen und Patienten machen die Darstellung lebendig und überzeugend.
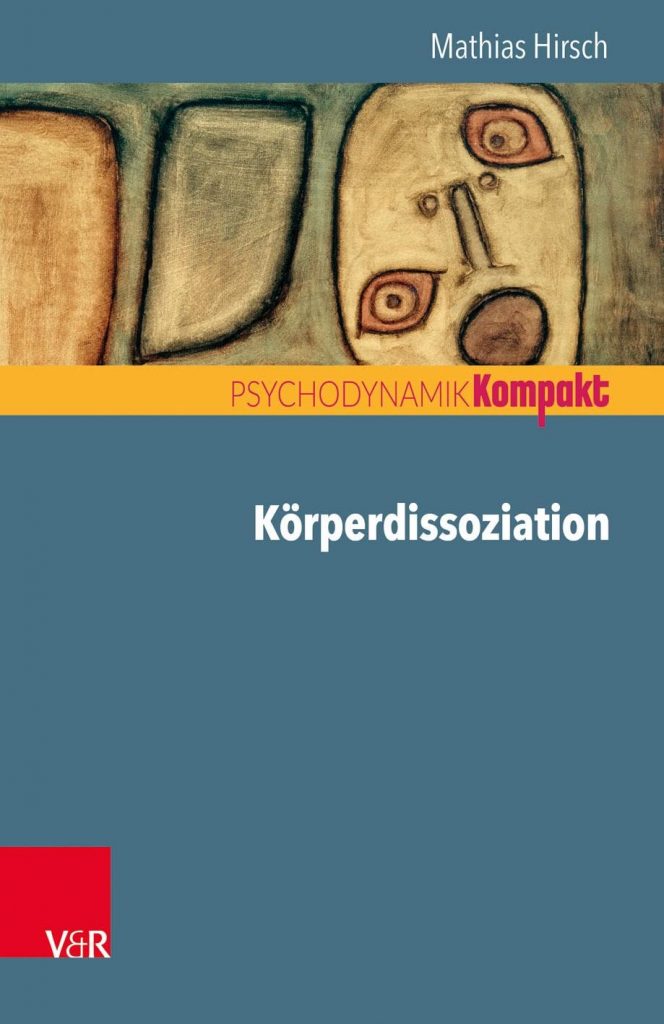
Vandenhoeck & Ruprecht
Serie Psychodynamik kompakt
erste Auflage Juni 2018
82 Seiten, Brochur
ISBN 978-3525406441
Neuauflage 2017:
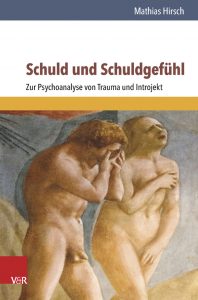
7., überarbeitete Auflage 2017:
Schuld und Schuldgefühl
Zur Psychoanalyse von Trauma und Introjekt
324 Seiten 5 Abb. Paperback
ISBN 978-3-525-01473-8
Vandenhoeck & Ruprecht
Schuld und das Gefühl von Schuld sind zentrale Topoi der menschlichen Existenz. In der Mythologie, in der Dramatik, im täglichen Umgang zwischen Menschen – überall gilt Schuld wie ein Kompass für das Verhalten. Selbstverständlich hat sich Sigmund Freud beim Entwurf seiner Tiefenpsychologie von Anfang an der Schuld und des Schuldgefühls angenommen und in dieser Differenzierung bereits die Dialektik von Schuld und Schuldgefühl deutlich gemacht: Schuldgefühl ist nicht nur ein Problem des Täters, sondern, im Ödipus-Konflikt etwa, das untätige Fühlen und Wünschen allein bringt das Gefühl von Schuld hervor. Das Gewissen, bei Freud das Über-Ich, konstituiert sich aus Schuldgefühlen und macht so den Menschen erst schuldfähig, aber dadurch auch fähig zu reifen.
In der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie kann die Schuld des Täters als eine Seite des Traumas gesehen werden, das durch Gewalttätigkeit gegen das Opfer, ihrer Annahme und Introjektion und schließlich Identifikation zum Schuldgefühl des Opfers geworden ist. Wenn die Psychoanalyse die so beschaffene Schuld des einstigen Opfers erkennt, muss sie in der Therapie zwischen Schuld und Schuldgefühl sorgfältig unterscheiden. Mathias Hirsch stellt in diesem grundlegenden Werk eine Systematik des Schuldgefühls vor, die ein differenziertes Feld erschließt:
– ein Basisschuldgefühl (aufgrund der bloßen unerwünschten Existenz),
– ein Vitalitätsschuldgefühl (aufgrund behinderter vitaler Bedürfnisse),
– ein Trennungsschuldgefühl (wegen verspäteter Autonomiebestrebungen),
– ein traumatisches Schuldgefühl (aufgrund der Internalisierung traumatischer Gewalt).
Mütter und Söhne – blasse Väter.
Sexualisierte und andere Dreiecksverhältnisse. Psychosozial-Verlag, Gießen 2016
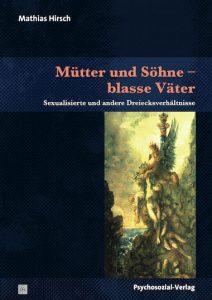
Das Buch widmet sich der sexualisierten Übergriffigkeit von Müttern auf ihre Söhne. Die Psychodynamik und die traumatischen Folgen einer inzestuösen Nähe zur Mutter wird differenziert beschrieben, die durch einen abwesenden oder schwachen Vater begünstigt wird. Der inzestuös gebundene Sohn muss als Erwachsener entweder Macht über sein Liebesobjekt ausüben, um damit die panische Angst vor Nähe, die durch die ursprüngliche Traumatisierung entstanden ist, abwehren zu können, oder er begibt sich in eine masochistische Position und identifiziert sich mit der Opferrolle.
182 Seiten, Broschur, ISBN-13: 978-3-8379-2602-6
Hirsch, M. (2012): „Goldmine und Minenfeld“ – Liebe und sexueller Machtmissbrauch in der analytischen Psychotherapie und in anderen Abhängigkeitverhältnissen. Psychosozial-Verlag, Gießen

Liebe in Psychotherapie und Psychoanalyse und die Überschreitung der Grenzen der therapeutischen Beziehung durch sexuellen Missbrauch sind zwei noch immer tabuisierte Bereiche. Die Übertragungsliebe war von Beginn an ein Markenzeichen der Psychoanalyse (»Goldmine«), allerdings erliegen immer wieder Psychoanalytiker und Psychotherapeuten ihrer sexuellen Gegenübertragung, indem sie sie in eine reale sexuelle Beziehung wandeln (»Minenfeld«). Werden narzisstische Größenphantasien und sexualisierte Macht gegenüber Abhängigen ausgelebt, hat dies stets katastrophale Folgen – oft für beide Beteiligten.
Das vorliegende Buch befasst sich mit dem Spektrum der Liebe in der therapeutischen Beziehung und der Überschreitung ihrer Grenzen. Die Täter-Opfer-Dynamik wird erarbeitet und die Parallelen zum familiären sexuellen Missbrauch und zur sexuellen Ausbeutung in reformpädagogischen und konfessionellen Institutionen werden verdeutlicht: Die Verantwortung liegt immer bei dem, der seine Professionalität verrät, sie liegt aber auch bei den Institutionen, die oft die Täter schützen und die Opfer vernachlässigen.
241 Seiten, Broschur, ISBN-13: 978-3-8379-2221-9
Hirsch, M. (2011): Trauma. Psychosozial-Verlag, Gießen
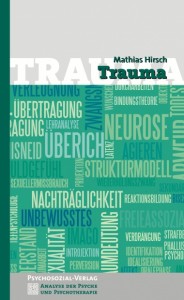
Die Psychoanalyse begann als Traumatheorie, entwickelte sich zur Triebpsychologie und kann heute als Beziehungspsychologie verstanden werden, die (traumatisierende) Beziehungserfahrungen als Ursache schwerer psychischer Störungen sieht. Dabei dient die Internalisierung von Gewalterfahrungen eher der Bewältigung lang andauernder »komplexer« Beziehungstraumata, akute Extremtraumatisierungen haben hingegen Dissoziationen zur Folge. Während eine psychoanalytische Therapie »komplex« traumatisierter Patienten die therapeutische Beziehung ins Zentrum stellt und sich vielfältiger metaphorischer Mittel bedient, erfordern akute Extremtraumatisierungen, die zu Posttraumatic Stress Disorder führen können, ein verhaltensmodifizierendes, auch suggestives Vorgehen. Der Begriff »Trauma« sowie der Umgang mit Traumatisierung in der Therapie werden vorgestellt.
138 Seiten, Broschur, ISBN-13: 978-3-8379-2056-7
Hirsch, M. (2010): „Mein Körper gehört mir, und ich kann mit ihm machen, was ich will!“ Dissoziation und Inszenierungen Körpers. Psychosozial-Verlag, Gießen
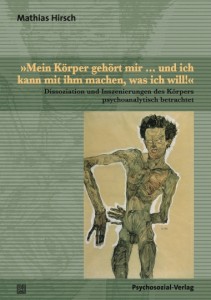
Das Interesse an der psychoanalytischen Bedeutung des Körpers hält unvermindert an, und zwar sowohl im großen gesellschaftlichen Rahmen – man denke an Fitness und Schönheitschirurgie – als auch im pathologischen Sinne: Selbstbeschädigung und Essstörungen sind die modernen Krankheitsbilder der Adoleszenz. Diese Störungen haben hauptsächlich den Zweck, wenigstens den Körper beherrschen zu können, wenn man sonst machtlos ist, und einen (Körper-)Teil zu opfern, um das Ganze zu retten. Zur Identitätssicherung haben die Menschen schon immer ihren Körper verändert und manipuliert, als würde er zwar zum Selbst gehören, gleichzeitig aber wie ein Objekt, wie ein äußeres Stück Natur behandelt und malträtiert werden können. Das Buch veranschaulicht die oft komplizierten psychischen Verhältnisse durch viele Praxisbeispiele des teilweise skurrilen zeitgenössischen Umgangs mit dem Körper.
336 Seiten, Broschur, ISBN-13: 978-3-8379-2091-8
Hirsch, M. (2008): „Liebe auf Abwegen“ – Spielarten der Liebe im Kino aus psychoanalytischer Sicht. Psychosozial-Verlag, Gießen
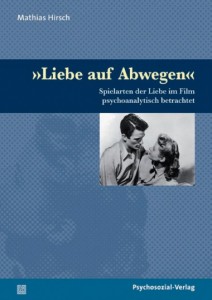
In den vergangenen Jahren ist das Kino immer mehr ins Interesse der Psychoanalytiker gerückt. Der Zuschauer kann sich berühren lassen und den Film als verschlüsselte Narration des eigenen Unbewussten verstehen. Er kann aber auch beruhigt das Eigene als Fremdes auf der Leinwand belassen. Dies ist ein Sinn des Voyeurismus. Der Film wird den unbewussten Motiven, Begierden, auch den Ängsten des Zuschauers entsprechen, ihn aber nicht dauerhaft verändern. Insofern ist Guattaris Spruch, das Kino sei »die Couch der Armen«, nicht mehr als ein witziges Bonmot.
Alle Filme, die in diesem Buch vorgestellt werden, führen uns in die Abgründe und Abwege der Liebe, die auch in uns als menschliche Möglichkeiten enthalten sind: Der Weg geht von der Mutterliebe, dem Inzest, der einen oder anderen Form der Perversion, der Ehe und der Selbstliebe bis hin zur Liebe in der Psychotherapie.
Folgende Filme werden vorgestellt: »Dancer in the Dark«, »Herbstsonate«, »Die Rückkehr«, »Die Vögel«, »Farinelli – Il Castrato«, »Ein Herz im Winter«, »El/Er«, »Belle de Jour«, »Der Nachtportier«, »Aguirre, der Zorn Gottes«, »Das Fest«, »La Fleur du Mal- Die Blume des Bösen«, »Spellbound – Ich kämpfe um dich«, »Intime Fremde« und »Lemming«
198 Seiten, Broschur, ISBN-13: 978-3-8980-6842-0
Hirsch, M. (Hg.) (2008): Die Gruppe als Container – Mentalisierung und Symbolisierung in der Gruppenanalyse. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
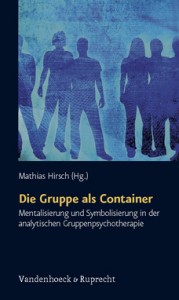
Seit über einem halben Jahrhundert wird die Psychoanalyse auf kleine Gruppen, insbesondere therapeutische Gruppen, angewendet. An diesem Ort ist sie immer interaktionell und intersubjektiv gewesen, Begriffe wie Übertragung und Gegenübertragung haben hier nur eine eingeschränkte Gültigkeit. So liegt es nahe, neue Vorstellungen von psychischen Reifungsprozessen der Mentalisierung und Symbolisierung auch auf die gruppenanalytische Situation zu beziehen. Die praxiserfahrenen Autoren haben sich dieser Aufgabe gestellt, und das Ergebnis ist die vielfältige Darstellung von Gruppenfaktoren, die Denken und Fühlen des Patienten verändern.
Nach einer Einführung in die neueren Mentalisierungs- und Symbolisierungsvorstellungen folgen Beiträge aus der psychoanalytischen Gruppenpsychotherapie, die das Thema in fast erzählerischer Weise behandeln. Darüber hinaus wird über die frappierenden Veränderungen der Mentalisierungskapazität postpartal depressiver Mütter berichtet, die voneinander und von ihren Babys in der Gruppe lernen, über Mentalisierung und Symbolisierung durch die Verwendung von Körperarbeit und von verschiedenen Medien in der Gruppe sowie über das »Mentalisation-based Treatment«, das Bateman und Fonagy entwickelt haben. Ein ausführliches Beispiel aus der gruppenanalytischen Praxis schließt den Band ab.
Mit Beiträgen von: Mathias Hirsch, Paula Teresa Carvalho, Peter Potthoff, Angelika Staehle, Thomas Bolm, Fernanda Pedrina, Sabine Trautmann-Voigt und Bernd Voigt.
2. Auflage 2010, 267 Seiten, kartoniert, ISBN 978-3-525-49132-4
Hirsch, M. (2008): Die Matthäus-Passion Johann Sebastian Bachs. Ein psychoanalytischer Musikführer. Psychosozial-Verlag, Gießen
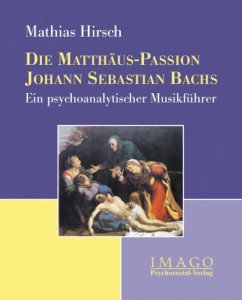
Bachs Musik verbindet in unnachahmlicher Weise den Text mit Affekten des Dramas, die im Hörer hervorgerufen werden. Die Passionsgeschichte nach Matthäus zeigt das Leiden Jesu Christi. Aus psychoanalytischer Sicht ist sie ein Beziehungsdrama, in dem Liebe, Verrat und Verlassenwerden Schuld erzeugen und dank der (nicht zuletzt musikalischen) Verarbeitung durch Reue schließlich Versöhnung entsteht.
Die dramatische Handlung und ihre musikalische Überhöhung laden zu vielfältigen Identifikationen ein: zur Abwehr des tragischen Geschehens, zur Identifikation mit Jesus als Leidenden, vom Vater Verlassenen, zur Identifikation mit den am Tod Jesu Schuldigen und zur Identifikation mit einer Rollenumkehrung. So fühlt sich der Hörer als Kind zur Rettung der leidenden Mutterfigur verpflichtet. Die Matthäuspassion ist musikalische Trauerarbeit, konfrontiert mit dem eigenen Tod und erreicht mit musikalischen Mitteln die Versöhnung mit der Begrenztheit der Conditio Humana.
155 Seiten, Broschur, ISBN-13: 978-3-8980-6755-3
Hirsch, M. (Hg.) (2006): Das Kindesopfer – eine Grundlage unserer Kultur.
Psychosozial-Verlag, Gießen
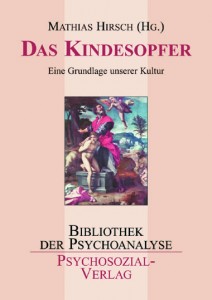
Der Mensch tötet Artgenossen, teilweise zum Zweck der Opferung. Der Schutz der Nachkommenschaft muss für höhere Ziele zurücktreten. Man opfert den Göttern das eigene Kind als »Bezahlung« für die nächste Ernte, Gesundheit, Sieg über Feinde, letztlich die Sicherung des Lebens in der Kultur des Menschen, der nicht mehr selbstverständlich in die Natur eingebettet ist. Diese Opferbereitschaft wirkt bis heute fort, man denke an die aktuelle Dynamik islamischer Selbstmordattentäter.
Das Menschheitsthema »Kindesopfer« – dominant in Mythologie, Literatur und Theater – behandeln die Autoren in gruppen- und psychodynamisch fundierter Weise aus verschiedenen Perspektiven. So werden Sinn und Dynamik des Kindesopfers und ein ganzes Spektrum von Gründungsmythen untersucht und es wird klar, dass am Beginn einer Kulturentwicklung häufig ein Opfermythos steht – die Geschichte von Abraham und Isaak begründet die jüdische, der Opfertod Jesu Christi die christliche Kultur, und man kann sagen, dass der Ödipus-Mythos die Psychoanalyse begründete.
Mit Beiträgen von: Mathias Hirsch, Eberhard Th. Haas, Wilfried Ruff, Felix de Mendelssohn, Matthias Franz, Thomas Auchter.
217 Seiten, Broschur, ISBN-13: 978-3-8980-6925-0
Hirsch, M. (2006): Das Haus. Symbol für Geburt und Tod, Freiheit und Abhängigkeit. Psychosozial-Verlag, Gießen
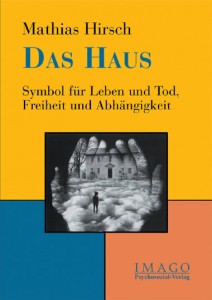
»Wenn das Haus fertig ist, kommt der Tod.« (türk. Sprichwort)
Das Haus verbinden wir mit Geborgenheit und Sicherheit. Es ist Teil unserer Sehnsuchtsliebe nach der idealisierten Kindheit im Elternhaus, und gleichzeitig symbolisiert es eigene Zukunftswünsche nach Selbständigkeit im eigenen Haus. Das eigene Haus bedeutet aber auch ein Festgelegt-Sein, ein Stück Unfreiheit: Individualität wird zur Konformität, Freiheit zur Festlegung, Sicherheit zur Abhängigkeit. Möchte man sich im Haus selbst eine mütterliche Hülle schaffen, entdeckt man über kurz oder lang mit unheimlichem Gefühl, dass es auch den Charakter des Grabes annehmen kann. So ist das Haus und jede seiner Formen ein Kristallisationspunkt eines basalen ambivalenten Autonomie-Abhängigkeitskonflikts, den wir alle kennen und dem das Buch nachgeht: witzig und hintergründig – kulturwissenschaftlich und psychoanalytisch.
217 Seiten, Broschur, ISBN-13: 978-3-8980-6512-2
Hirsch, M. (2004): Psychoanalytische Traumatologie – Das Trauma in der Familie – Psychoanalytische Theorie und Therapie schwerer Persönlichkeitsstörungen. Schattauer, Stuttgart
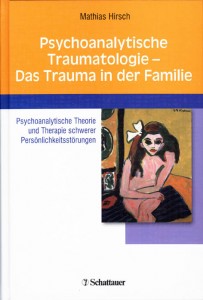
Es ist ein merkwürdiges gesellschaftliches Phänomen: Erst vor ungefähr 20 Jahren kam Traumatisierung infolge politisch-rassistischer Verfolgung oder durch Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauch in der Familie aus einer gründlichen Verdrängung an die Oberfläche. Inzwischen ist das Trauma in den Vordergrund der wissenschaftlichen Diskussion und der therapeutischen Bemühungen gerückt; heute versteht man schwer gestörte bzw. persönlichkeitsgestörte Patienten weitgehend als Opfer von Traumatisierungen.
Zeitgenössische psychoanalytische Therapie schwer traumatisierter Patienten erfordert ein flexibles Vorgehen zwischen Halten und Grenzen-Setzen, Verstehen und Konfrontieren bis hin zum spielerischen psychodramatischen Mitagieren. Mathias Hirsch hat seine Konzepte für den prototypischen Extremfall von familiärer Traumatisierung aus seiner jahrelangen Erfahrung mit der psychoanalytischen Therapie derart betroffener Patienten erarbeitet. Er stellt hier sowohl die theoretischen und historischen Grundlagen als auch die psychoanalytische Therapie ausführlichst dar. Das Ergebnis ist ein hochaktuelles Buch über moderne Psychoanalyse bzw. psychodynamische Psychotherapie.
Aus dem Inhalt
Die Entwicklung psychoanalytischer Traumakonzepte (z.B. der Traumabegriff bei Freud, das Modell von Ferenczi, Akut- und Extremtraumatisierungen, Dissoziation als Traumafolge, transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen, Trauma und Kreativität)
Psychoanalytische Therapie bei Persönlichkeitsstörungen (z.B. Entwicklung der Symbolisierungsfähigkeit in der therapeutischen Beziehung, Übertragung und Gegenübertragung, aktive Elemente in der Traumatherapie, analytische Gruppenpsychotherapie)
316 Seiten, kartoniert, ISBN: 978-3-7945-2317-7
Hirsch, M. (Hrsg.) (2002): Der eigene Körper als Symbol? Der Körper in der Psychoanalyse von heute. Psychosozial-Verlag, Gießen
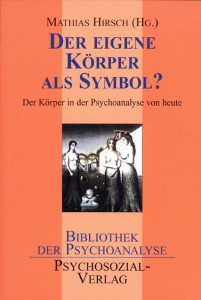
Aus psychoanalytischer Sicht wird die Bedeutung des Körpers als Symbol innerhalb verschiedener Bereiche der Psychopathologie untersucht, in denen er unbewältigte psychische Konflikte und Defizite, aber auch Traumafolgen und deren Abwehr mehr oder weniger symbolisch ausdrückt. Unter diesem Aspekt werden die »modernen« Krankheiten Selbstverletzung und Essstörungen bearbeitet, die Besonderheiten des therapeutischen Vorgehens bei wenig symbolisierten Körpersyndromen in Theorie und Praxis werden beschrieben und es wird die Kommunikationsfunktion des Körpers in der analytischen Psychotherapie untersucht. Ein Beitrag befasst sich mit nichtsymbolisierten Körpersymptomen in frühester Kindheit, ein anderer stellt die Verbindung zu zeitgenössischen Formen der Körperkultur wie Tattoo und Piercing her. In der Abhandlung über die Geschichte der Psychoanalyse werden die Ursprünge der Symbolbedeutung des Körpers aufgespürt und ihre Weiterentwicklung nachvollzogen. In weiteren Beiträgen sind literarische Werke Gegenstand der Untersuchung zum Thema Symbolfunktion des eigenen Körpers.
Mit Beiträgen von: Mathias Hirsch, Margarete Berger, Christel Böhme-Bloem, Gerhard Paar, Fernanda Pedrina, Reinhard Plassmann, Aglaja Stirn, Volker Trempler.
281 Seiten, Broschur, ISBN-13: 978-3-8980-6138-4
Hirsch. M. (Hrsg.) (2000): Psychoanalyse und Arbeit. Psychoanalytische Blätter 14, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
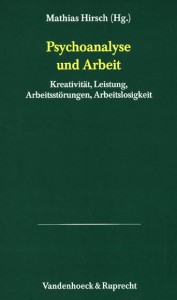
vergriffen, nicht mehr erhältlich
Hirsch, M. (1997): Schuld und Schuldgefühl. Zur Psychoanalyse von Trauma und Introjekt. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen
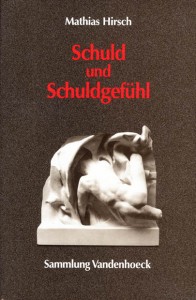
Seit biblischen Zeiten sind Schuld und das Gefühl von Schuld ein zentraler Topos der menschlichen Existenz. In der Mythologie, in der Dramatik, im täglichen Umgang zwischen Menschen – überall gilt Schuld wie ein Kompass für das Verhalten. Selbstverständlich hat sich Sigmund Freud beim Entwurf seiner Tiefenpsychologie von Anfang an der Schuld und des Schuldgefühls angenommen und in dieser Differenzierung bereits die Dialektik von Schuld und Schuldgefühl deutlich gemacht: Schuldgefühl ist nicht nur ein Problem des Täters, sondern, im Ödipus-Konflikt etwa, das untätige Fühlen und Wünschen allein bringt das Gefühl von Schuld hervor. Das Gewissen, bei Freud das Über-Ich, konstituiert sich aus Schuldgefühlen und macht so den Menschen erst schuldfähig, aber dadurch auch fähig zu reifen.
In der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie kann die Schuld des Täters als eine Seite des Traumas gesehen werden, das durch Gewalttätigkeit gegen das Opfer, ihrer Annahme und Introjektion und schließlich Identifikation zum Schuldgefühl des Opfers geworden ist. Wenn die Psychoanalyse die so beschaffene Schuld des einstigen Opfers erkennt, muss sie in der Therapie zwischen Schuld und Schuldgefühl sorgfältig unterscheiden. Mathias Hirsch stellt in diesem grundlegenden Werk erstmalig eine Systematik des Schuldgefühls vor, die ein differenziertes Feld erschließt:
ein Basisschuldgefühl (aufgrund der bloßen unerwünschten Existenz),
– ein Vitalitätsschuldgefühl (aufgrund behinderter vitaler Bedürfnisse),
– ein Trennungsschuldgefühl (wegen verspäteter Autonomiebestrebungen),
– ein traumatisches Schuldgefühl (aufgrund der Internalisierung traumatischer Gewalt).
6. unveränd. Aufl., 341 Seiten mit 5 Abb. kartoniert, ISBN 978-3-525-01435-6
Hirsch, M. (Hrsg.) (1989): Der eigene Körper als Objekt. Zur Psychodynamik selbstdestruktiven Körperagierens. Springer: Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, Hong Kong. Unveränd. Neuaufl. Psychosozial-Verlag, Gießen (1998)
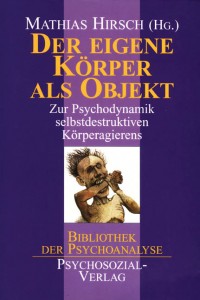
Die Häufigkeit schwerer psychischer Störungen scheint zu wachsen, in denen der eigene Körper wie ein äußeres Objekt erlebt und in der Phantasie sowie durch entsprechendes Agieren destruktiv behandelt wird. Solche Krankheitsbilder zwischen schweren psychischen und psychosomatischen Störungen reichen von Hypochondrie und Depersonalisation über die Essstörung bei Anorexie bis hin zu den verschiedenen Formen der Selbstbeschädigung bzw. Herstellung artifizieller Krankheit. Stets handelt es sich dabei um den Versuch, durch Abspaltung des Körperselbst das Gesamtselbst zu erhalten. Alle diese nosologischen Einheiten werden in diesem Buch phänomenologisch beschrieben und auf psychoanalytischer Grundlage ausführlich auf ihre Psychodynamik hin untersucht.
Mit Beiträgen von: Mathias Hirsch, Margarete Berger, Michael Dümpelmann, Heinz Neun, Reinhard Plassmann, Ulrich Sachsse, Hans Willenberg.
312 Seiten, Broschur, ISBN-13: 978-3-9321-3333-6
Hirsch, M. (1987): Realer Inzest. Psychodynamik des sexuellen Mißbrauchs in der Familie. Springer: Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo. 3., überarbeitete Auflage. Unveränd. Neuaufl. Psychosozial-Verlag, Gießen (2013)
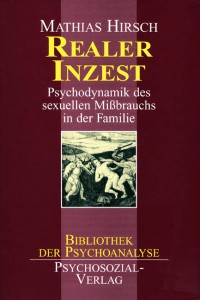
Bei dem hier behandelten Inzest geht es um eine Form der Kindesmisshandlung, in der ein Erwachsener ein ihn liebendes, von ihm abhängiges Kind für seine sexuellen Bedürfnisse ausbeutet. Würde das Kind das ganze Ausmaß an Verrat realisieren, könnte es die Beziehung, auf die es existenziell angewiesen ist, nicht mehr ertragen. So hilft es sich, indem es die Schuld auf sich nimmt, um sich erklären zu können, was der geliebte Erwachsene ihm antut, und um bei ihm bleiben zu können.
291 Seiten, Broschur, ISBN-13: 978-3-8379-2296-7
